Züchtung
Durch züchterische Maßnahmen können natürlich ablaufende Vorgänge beschleunigt werden. Dies bietet die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der Evolutionsfaktoren zu testen. Züchtungsstudien zeigen, dass ein erhebliches Variationspotential ausgeschöpft werden kann, dass die Veränderungsmöglichkeiten aber an Grenzen stoßen.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel werden Züchtungsmethoden, Züchtungsziele und einige Beispiele von Züchtungsergebnissen vorgestellt. Daraus werden Schlussfolgerungen über die Leistungsfähigkeit der Evolutionsmechanismen gezogen.
1.1 Einleitung
In den beiden vorhergehenden Artikeln wurden die Evolutionsfaktoren „Mutation“ (https://genesis-net.de/e/1-3-b/2-1/) und „Selektion“ (https://genesis-net.de/e/1-3-b/2-2/) vorgestellt. Mutationen und Selektionsvorgänge geschehen nachweislich in der Natur. Beides kann man auch experimentell nachvollziehen. In der klassischen Züchtungsforschung werden natürlich ablaufende Vorgänge von Mutation, Rekombination und Selektion nachgeahmt und durch gezielte Eingriffe beschleunigt. Dies gelingt durch eine Erhöhung der Mutationsrate, durch gezieltes Kreuzen sowie durch künstliche Auslese (Abb. 62).

Abb. 62: Steigerung der Geschwindigkeit des Variationsprozesses (Mikroevolution) durch gezielte züchterische Maßnahmen. Quelle: R. Junker & S. Scherer: Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen 2001.
Durch züchterische Maßnahmen können in der Natur meist sehr langsam ablaufende Vorgängen stark beschleunigt werden. Daher sind Züchtungsstudien für die Evolutionsforschung von Interesse. Veränderungen können in viel kürzerer Zeit erzielt werden, so dass die Möglichkeiten und Grenzen der Wandelbarkeit der Lebewesen besser eingeschätzt werden können.
1.2 Klassische Züchtungsmethoden
Im Artikel über „Mutation“ (https://genesis-net.de/e/1-3-b/2-1/) wurde bereits erwähnt, dass Mutationen nicht nur spontan im Freiland auftreten, sondern auch künstlich ausgelöst werden können. Auf diese Weise wird in der Züchtungsforschung versucht, das Spektrum der Varianten zu erhöhen (Mutationszüchtung). Dies ist allerdings nur bedingt gelungen (s. u.). Auch Selektion (Auslese) kann künstlich erfolgen. An die Stelle der natürlichen Auslese (hervorgerufen durch Umweltbedingungen) tritt der Mensch als Züchter, der aus der Formenvielfalt innerhalb einer Art bestimmte Varianten auswählt, die für seine Züchtungsvorhaben nützlich sind. Er scheidet also denjenigen Teil aus der vorhandenen Vielfalt aus, der seinem Züchtungsziel nicht dient. Das ist Selektion: Auslesezüchtung. Der Züchter kreuzt außerdem ausgewählte Individuen mit gewünschten Eigenschaften, um genau diese Eigenschaften zu optimieren. Durch geschicktes Kreuzen von Formen mit verschiedenen wünschenswerten Merkmalen kann es u. U. gelingen, eine günstige Kombination von Merkmalen zu erreichen: Kombinationszüchtung.
1.3 Rekombination
Kombination von Erbfaktoren wird auch als Rekombination bezeichnet. Rekombination gibt es bei jeder sexuellen Fortpflanzung. Verschiedene Mechanismen bei der Bildung der Geschlechtszellen sowie die Befruchtung führen dazu, dass das Erbgut neu kombiniert wird. Man kann diesen Vorgang mit dem Mischen beim Kartenspiel vergleichen. Die Karten bleiben insgesamt dieselben, doch ihre Kombinationen sind in verschiedensten Weisen möglich. Durch gezieltes Kreuzen kann der Züchter versuchen, bestimmte Kombinationen zu fördern.
1.4 Züchtungsziele
Züchtungsziele sind z. B. Steigerung der Korngröße bei Getreide oder allgemein Vergrößerung von Früchten, Verlust der Spindelbrüchigkeit bei Getreide, Erhöhung des Gehalts von Inhaltsstoffen (z. B. von Zucker in der Zuckerrübe), Gleichzeitigkeit der Fruchtreife bei Nutzpflanzen, Verbesserung des Geschmacks oder der Haltbarkeit u. v. a. (vgl. Abb. 63).

Abb. 63: Ein typisches Merkmal von Zuchtpflanzen ist der Verlust von Verbreitungsmitteln. So besitzt der Saat-Hafer (rechts) weder eine Spelzenbehaarung noch eine Granne. Beides hilft dem wildwachsenden Flughafer (links) bei der Verankerung der Grasfrüchte im Boden. Quelle: R. Junker & S. Scherer: Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen 2001.
1.5 Ergebnisse
Viele Züchtungsziele und -ergebnisse sind zwar wirtschaftlich sinnvoll, aber im Freiland unzweckmäßig, etwa der Verlust von Verbreitungsmitteln (Abb. 63), die Gleichzeitigkeit der Samenreife, Verlust von Giftstoffen, gefüllte Blüten (geringere Fruchtbarkeit; vgl. Abb. 64). Bei diesen Beispielen treten Verluste ein, die unter bestimmten Bedingungen vorteilhaft sein können. Aber auch in anderen Fällen erfolgt keine Neubildung von Strukturen. Die Unterschiede gegenüber den Wildformen sind in der Regel nur quantitativer Natur, z. B. Ausbildung größerer Früchte, einer größeren Kornzahl, von mehr Halmen pro Pflanze, eines größeren Farbstoffgehalts (Abb. 64) usw.).

Abb. 64: Gefüllte Blüten bei einer Zuchtform des Gänseblümchens (links). Die Zuchtform unterscheidet sich von der Wildform (rechts) durch die Vermehrung der sterilen Zungenblüten auf Kosten der fruchtbaren kleinen (gelben) Röhrenblüten und durch einen höheren Farbstoffgehalt. Den roten Farbstoff besitzt aber auch die Wildform. Quelle: R. Junker & S. Scherer: Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen 2001.
Wieder in anderen Fällen mag ein Merkmal eine gewisse Abwandlung erfahren, so dass auch in gewissem Sinne eine neue Qualität auftritt, die aber eine bereits vorhandene komplexe Ausgangssituation benötigt (beispielsweise beim Erwerb einer Giftresistenz; vgl. Artikel über „Mutation“ (https://genesis-net.de/e/1-3-b/2-1/)). Manche Änderungen wiederum beruhen darauf, dass die Entwicklung teilweise nur bis zum Jugendstadium verläuft. So weist der Pekinesenschädel eine jugendliche Form auf (Abb. 65).
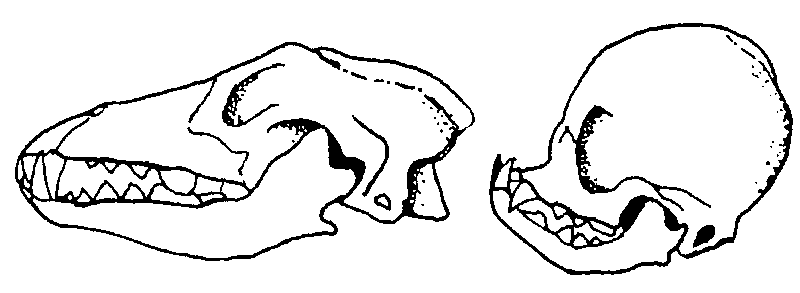
Abb. 65: Schädel des Wolfs (links) und des Pekinesen mit extrem verkürzter Schnauze. Quelle: R. Junker & S. Scherer: Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen 2001.
Die Mutationsforschung hat gezeigt, dass das Mutationsspektrum nicht beliebig erweitert werden kann, sondern nach einer gewissen Zeit ausgereizt ist, so dass immer wieder die gleichen Mutationen auftreten (Regel von der rekurrenten Variation, vgl. den Artikel über „Mutation“ (https://genesis-net.de/e/1-3-b/2-1/)). Außerdem sind die künstlich ausgelösten Mutation oft mit den natürlich (spontan) auftretenden identisch. Daher spielt die Mutationsforschung in der Zucht kaum noch eine Rolle. Das Mutantenspektrum kann offenbar nicht beliebig erweitert werden.
Durch Kreuzungen, die oft auch artübergreifend möglich sind, können neue Merkmalskombinationen und damit neue Sorten erzeugt werden. Dabei wird vorhandenes genetisches Potential ausgenutzt und kombiniert, jedoch kein neues erzeugt.
Auch Selektion führt nicht zu immer wieder neuen Sorten, sondern zu Grenzen der Wandelbarkeit. So können die Eierlegezahlen bei Hühnern, die Milchproduktion von Kühen oder der Zuckergehalt von Zuckerrüben nicht endlos gesteigert werden. Und offensichtlich führen solche Steigerungen nicht zu neuen Strukturen im Sinne von Makroevolution. Durch künstliche Auslese können Extremvarianten und einseitige Spezialisierungen ausgeprägt werden. Wenn das Auslesepotential (die anfangs vorhandene genetische Vielfalt) ausgereizt ist, sind keine weiteren Veränderungen auf diesem Wege mehr möglich. Fortgesetzte künstliche Selektion führt zur Verminderung der Variabilität und Spezialisierungen. Spezialisierungen und einseitige Anpassungen führen schließlich in evolutionäre Sackgassen.
1.5 Züchtung – ein Modell für natürliche Vorgänge?
Die Züchtungsforschung liefert nur bedingt ein Modell für Evolution und ist kein Vorbild für makroevolutionäre Vorgänge. Der Züchter liest meist nach ganz anderen Kriterien aus als die Natur; für die allgemeine Überlebens- und Konkurrenzfähigkeit sind die Züchtungsziele in der Regel kontraproduktiv. Die Zuchtformen sind daher oft weniger vital als die Wildformen, so dass sie oft nur unter der Obhut des Züchters überleben.
Die Variationsmechanismen sind aber durchaus dieselben wie die im Freiland ablaufenden Vorgänge. In diesem Sinne kann Züchtung durchaus als Modell für im Freiland ablaufende Veränderungen betrachtet werden. Für Makroevolution stellen Züchtungsvorgänge kein Modell dar, da die Entstehung neuer Strukturen durch Züchtung nicht erreicht werden konnte.
Autor: Reinhard Junker, 01.01.2004
Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i41243.php