Grundzüge der Evolutionslehre
„Evolution“ heißt wörtlich „herauswälzen“, das Ausprägen von bereits fertigen Anlagen. Im Rahmen der Evolutionslehre wird dieser Begriff jedoch paradoxerweise anders verstanden. Ohne vorherige Anlagen soll immer wieder ganz Neues durch natürliche Vorgänge entstanden sein.
1.0 Inhalt
Was bedeutet „Evolution“ und welches sind die hauptsächlichen Inhalte der Evolutionslehre? In diesem Artikel wird die Geschichte des Lebens in evolutionstheoretischer Perspektive kurz zusammengefasst.
1.1 Kurzgefasster Inhalt der Evolutionslehre
Die heute vertretenen Evolutionsvorstellungen in der Biologie beinhalten eine Reihe von Gemeinsamkeiten:
- Die Lebewesen besitzen die Fähigkeit, ihr Erscheinungsbild im Laufe der Zeit zu verändern. Diese Veränderungen haben genetische (erbliche) Grundlagen.
- Das erste Lebewesen entstand durch Selbstorganisationsprozesse aus anorganischen Stoffen. Diskutiert wird auch eine Infektion mit Lebewesen oder ihren Vorstufen aus dem Weltraum.
- Alle heute lebenden Organismen und alle fossil bekannten Arten, seien es Bakterien, Pilze, grüne Pflanzen oder Tiere, sind miteinander abstammungsverwandt. D. h. sie stammen von einfacher gebauten Vorläufern und letztlich von einem einzelligen Urahn (dem ersten Lebewesen) ab (monophyletische Abstammung). Diese Entwicklung spielte sich über viele hunderte von Jahrmillionen in der Generationenfolge ab.
- Die Gesamtevolution des Lebens erfolgte durch einen Abwandlungs- und Verzweigungsprozess, der zu einem Stammbaum des Lebens geführt hat.
- Der Abwandlungsvorgang ist durch ausschließlich natürliche Prozesse abgelaufen. Evolutionsforschung hat das Ziel, diese Faktoren vollständig aufzuklären und die Evolutionswege im Einzelnen nachzuzeichnen.
1.2 Was heißt „Evolution“?
Nach der ursprünglichen Wortbedeutung heißt „Evolution“ Entwicklung, und zwar im Sinne des Ausprägens bereits angelegter Fähigkeiten. Das Wort stammt vom lateinischen „evolvere“, was wörtlich „herauswälzen, herausrollen, auswickeln“ heißt. Früher wurde dieser Begriff für die individuelle Entwicklung verwendet, in welcher sich tatsächlich bereits vorhandene Anlagen ausprägen. Doch paradoxer-
weise passt diese Bedeutung des sich „Auswickelns“ nicht zur modernen Abstammungslehre. Im 19. und auch noch teilweise im 20. Jahrhundert wurde der Begriff „Evolutionstheorie“ denn auch nicht gleichbedeutend mit „Abstammungslehre“ verwendet, vielmehr wurde diese als „Deszendenztheorie“ (= „Abstammungstheorie“) bezeichnet.
Dennoch wurde später der Begriff „Evolution“ in der „Evolutionstheorie“ (bzw. der umfassenderen „Evolutionslehre“) übernommen und unversehens mit einem neuen Bedeutungsinhalt versehen. Mit dem stammesgeschichtlichen Evolutionsbegriff ist der Gedanke eines „Ausprägens“ von bereits Angelegtem nicht mehr verknüpft – im Gegenteil: genau dies wird ausdrücklich abgelehnt. Der Begriff „Evolution“ ist nur noch eine Metapher. Im Verlauf der stammesgeschichtlichen Evolution solle immer wieder völlig Neues entstanden sein, was in den jeweiligen Vorstufen noch nicht angelegt war.
1.3 Geschichte des Lebens nach der Evolutionslehre
Nach den Vorstellungen der Evolutionslehre soll das Leben auf der frühen Erde vor ca. 3,5 bis 4 Milliarden Jahren begonnen haben. Erste Lebensformen sind demnach durch eine chemische Evolution allein durch physikalisch-chemische Prozesse entstanden. Der experimentell bestens bestätigte und niemals widerlegte Befund „Alles Leben kommt aus dem Leben“ („omne vivum ex vivo“) soll in einem Frühstadium unserer Erde nicht gegolten haben. Leben soll damals aus toten Stoffen entstanden sein.
Der erste Schritt der evolutionär gedeuteten Geschichte des Lebens liegt weitgehend im Dunkeln. Die Behauptung, damals sei Leben aus Nichtleben entstanden, ist durch keinerlei aussagekräftige und maßgebliche empirische Befunde bestätigt (siehe „Entstehung des Lebens“ (https://genesis-net.de/x/1-5/)).
An diesen ersten hypothetischen (oder eigentlich spekulativen!) Schritt des Lebensbeginns ausgehend soll sich eine biologische Evolution angeschlossen haben, in deren Verlauf das Leben ca. 3 Milliarden Jahre lang weitgehend auf dem Einzellerstadium stehen blieb. Man vermutet im Wesentlichen eine biochemische Evolution der Zelle in diesem Zeitraum, der erst gegen Ende des Präkambriums (Abb. 24) endet. Von wenigen, z. T. noch umstrittenen Ausnahmen abgesehen werden vielzellige Lebewesen erst ab dem obersten Präkambrium gefunden.
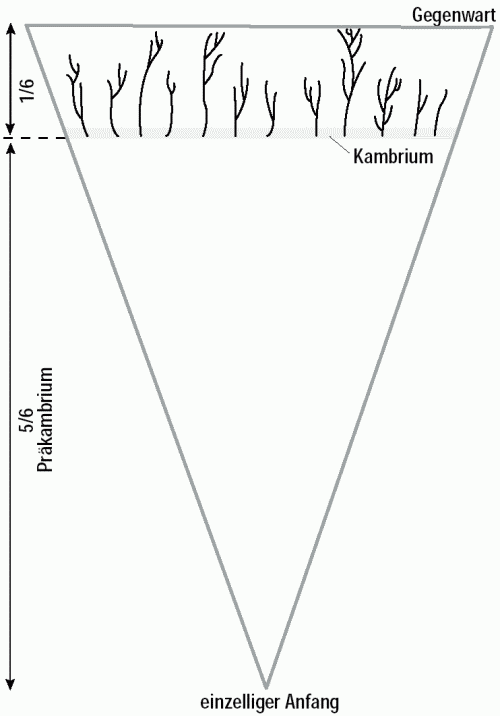
Abb. 24: „Kambrische Explosion“: Der Großteil der Geschichte des Lebens (während des Präkambriums) ist fossil fast nur durch Einzeller dokumentiert. Vielzeller tauchen dann im Kambrium ziemlich abrupt auf.
Vor allem ab dem Unterkambrium taucht dann explosionsartig eine beeindruckende Vielfalt von Bauplänen auf, und zwar in weltweiter Verbreitung. Dazu gehören Chordatiere, Stachelhäuter, Gliederfüßer, Weichtiere und verschiedene Gruppen von Würmern u. a. Dieser recht abrupte Beginn der Fossilüberlieferung von Vielzellern wird häufig als „Kambrische Explosion“ (https://genesis-net.de/x/1-7/2-2/) bezeichnet; manche Autoren sprechen auch bildhaft vom „Urknall der Paläontologie“.
Zwar sind ab dem Kambrium sehr verschiedene Baupläne vorhanden, aber insgesamt sind die Formen gegenüber der heutigen Tierwelt recht fremdartig. Es handelt sich bei den kambrischen Formen ausschließlich um wasserlebende Organismen. Erst später werden auch Landlebewesen fossil überliefert (Pflanzen und Wirbellose im Silur, Wirbeltiere ab dem Oberdevon). Nach der Deutung der Evolutionstheorie ist dies gleichbedeutend mit der evolutionären Eroberung des Landes. Um am Beispiel der Wirbeltiere zu bleiben: Ab dem Karbon weisen die fossil überlieferten Formen in der Schichtenfolge aufsteigend mehr und mehr Einrichtungen für das Landleben auf; nach den Amphibien tauchen Reptilien und schließlich auch Vögel und Säugetiere auf.
Entsprechende Abfolgen sind auch in der Fossilüberlieferung der Pflanzen zu verzeichnen. So sind nacktsamige Pflanzen (zu denen z. B. unsere heutigen Nadelgehölze gehören), schon aus dem Karbon bekannt, dagegen die Bedecktsamer erst ab der Unterkreide. (Die Bedecktsamer machen den weitaus größten Teil des heutigen Pflanzenkleides aus; zu ihnen gehören Laubbäume und zahlreiche krautige Formen.)
Der Mensch wird erst in den jüngsten geologischen Schichten gefunden; nach evolutionstheoretischer Lesart betrat er somit erst sehr spät die Bühne des Lebens.
Autor: Reinhard Junker, 13.02.2004
Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i41221.php