Atavismen
Manche gelegentlich auftretenden Missbildungen werden als Atavismen interpretiert, d. h. als Rückschläge in frühere stammesgeschichtliche Stadien. Daher gelten sie als Evolutionsbelege. Diese Interpretation ist jedoch nur selektiv anwendbar, wenn ein bestimmter Evolutionsverlauf bereits vorausgesetzt wird. Daher stellen Atavismen keine unabhängigen Belege für Evolution dar.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel wird erklärt, was Atavismen sind und weshalb sie als Belege für Makroevolution betrachtet werden. Weiter wird gezeigt, weshalb Atavismen nicht als Beweise für Makroevolution gelten können.
1.1 Das Atavismus-Argument
Indizien für Evolution werden auch aus der Teratologie gewonnen. Dabei handelt es sich um das Studium und die Lehre von den Missbildungen. Störungen in der individuellen Entwicklung können durch Mutationen, aber auch durch Umwelteinflüsse ausgelöst werden. Missbildungen gibt es in sehr großer Zahl, sie treten jedoch bei einzelnen Individuen sehr selten auf.
Manche Missbildungen weisen gewisse Ähnlichkeiten mit Strukturen mutmaßlicher Vorfahren der betreffenden Art auf. In diesen Fällen werden sie häufig als Atavismen bezeichnet. In dieser Bezeichnung steckt eine evolutionstheoretische Interpretation: „Atavismus“ kommt vom lateinischen atavus = Urgroßvater, Urahn. Die betreffenden missgebildeten Strukturen sollen also an die Ausprägung bei einem stammesgeschichtlichen Vorfahren erinnern. Man spricht von „Rückschlägen“ in stammesgeschichtlich früher verwirklichte Stadien. Als Atavismen werden beim Menschen Halsfisteln, ein ungewöhnlich stark ausgebildetes Haarkleid, Schwänzchen (Abb. 200) und überzählige Brustwarzen angeführt. Halsfisteln sind Kanäle im Bereich der äußeren Halshaut und dem Rachen, sie werden als offen gebliebene Kiemenspalten gedeutet (Rückschlag zum Fischstadium). Atypische Behaarung soll eine Erinnerung an felltragende Vorfahren sein, ebenso soll die Ausbildung einer schwanzartigen Bildung im Steißbereich auf geschwänzte Vorfahren hinweisen usw.

Abb. 200: Wurmartiges Anhängsel in der Region über der Lendenwirbelsäule, dem Kreuz- und Steißbein des Menschen.
Ein Beispiel für einen Atavismus bei Tieren sind zusätzlich auftretende Zehen bei Pferden (Abb. 201). In diesem Fall wird eine pro Fuß normalerweise nur einmal verwirklichte Struktur vermutlich aufgrund einer Fehlsteuerung (unnützerweise) zweimal ausgebildet.

Abb. 201: Atavistisch verlängertes Griffelbein mit atavistischen Zehenknochen und Huf bei einem Pferd.
1.2 Bewertung des Arguments
Wie die Rudimentären Organe (s. „Rudimentäre Organe“ (https://genesis-net.de/e/1-3-e/5-3/)) geben auch Atavismen keine direkten Hinweise auf eine progressive Evolution. Allerdings wird indirekt auf makroevolutive Veränderungen geschlossen, etwa wenn bestimmte als Atavismen gedeutete Missbildungen als Belege dafür gewertet werden, dass der Mensch fischartige Vorfahren hatte. Hier wird jedoch im Wesentlichen nur vergleichend-biologisch argumentiert, woraus keine stichhaltigen Belege für Makroevolution gewonnen werden können (vgl. „Ähnlichkeiten in der Morphologie und Anatomie“ (https://genesis-net.de/e/1-3-e/5-1/)). Denn die Mechanismen der indirekt erschlossenen hypothetischen Umbildungen sind nicht bekannt.
1.3 Kritik des Arguments
Mit den als Atavismen interpretierten Missbildungen wird inkonsequent argumentiert. Missbildungen werden nämlich nur sehr selektiv als Hinweise auf eine angenommene Stammesgeschichte gewertet (also als Atavismen interpretiert), wenn sie Ähnlichkeiten mit vermuteten Vorfahren des betreffenden Organismus aufweisen. Fast alle Missbildungen können aber nicht als evolutionär bedingte Rückschläge interpretiert werden, beispielsweise gegabelte Rippen, Hasenscharte, Sechsfingrigkeit, die Ausbildung von zwei Köpfen oder das Auftreten eines fünften Beines und viele andere. Diese Missbildungen sind mit Sicherheit keine Hinweise auf früher verwirklichte stammesgeschichtliche Stadien. Die Interpretation von Missbildungen als Atavismen ist also nur möglich, wenn ein bestimmter Evolutionsverlauf bereits vorausgesetzt wird. Daraus wird dann gefolgert, welche Missbildungen überhaupt als Rückschläge in frühere Stadien in Frage kommen könnten. Da das zu Beweisende somit vorausgesetzt wird, können Atavismen nicht als Belege für eine Stammesgeschichte gewertet werden. Die Tatsache, dass einige wenige Missbildungen an Ausprägungen bei mutmaßlichen Vorfahren der betrachteten Organismen erinnern, ist nicht besonders bemerkenswert und aufgrund vieler gestaltlicher Ähnlichkeiten nicht überraschend. Dazu kommt, dass Atavismen bei genauerer Betrachtung den mutmaßlichen Vorfahrenstrukturen keineswegs in jeder Hinsicht gleichen. Auch bei den atavistischen Strukturen selbst wird wieder selektiv argumentiert. So gibt es Pferde mit atavistischen zweizehigen Füßen (Abb. 201, s. o.), unter den fossilen Pferden sind allerdings nur drei- und vierzehige Formen bekannt.
Bei konsequenter Anwendung würde die atavistische Interpretation zu unsinnigen Schlussfolgerungen führen, wie das folgende Beispiel zeigt. Vierflügelige Fruchtfliegen-Mutanten (Abb. 57, unten rechts) werden als Hinweis dafür gewertet, dass die normalerweise zweiflügeligen Insekten (Dipteren) von vierflügeligen abstammen. Die Ausbildung von vier Flügeln wird als Atavismus interpretiert. Es gibt aber auch Fruchtfliegenmutanten mit vier Schwingkölbchen und ohne Flügel – eine zwecklose Konstruktion, die sicher nicht als Hinweis auf stammesgeschichtliche Vorfahren gewertet werden kann.
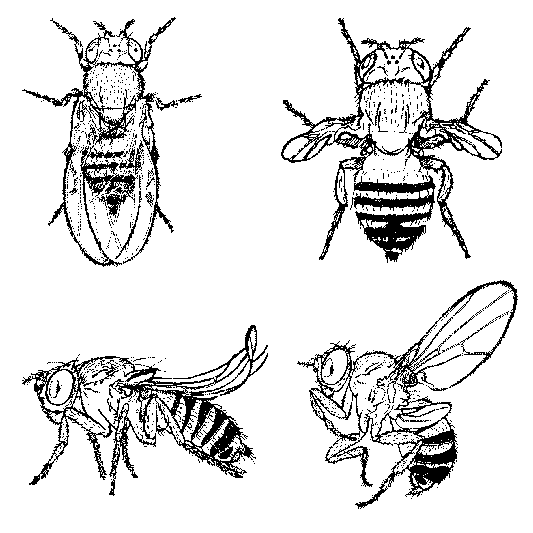
Abb. 57: Die 2-3 mm große Fruchtfliege Drosophila. Oben links: Normalform; oben rechts und unten links: zwei durch Mutation veränderte, flugunfähige Formen; unten rechts: eine vierflügelige Form, ebenfalls eine flugunfähige Missbildung. R. Junker & S. Scherer: Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen 2001.
Generell kann man zeigen, dass den Atavismen wie allen Missbildungen bestimmte Störungen der Formbildung zugrunde liegen, die auch ohne Rückgriff auf hypothetische stammesgeschichtliche Vorläufer verstanden werden können. Bei den Flügel-/Schwingkölbchen-Mutationen liegen Mutationen regulatorischer Gene zugrunde (vgl. „Homeobox-Gene und Evolution“ (https://genesis-net.de/e/1-3-c/3-5/)). Halsfisteln (s.o.) sind u.a. die Folge einer krankhaften Zerstörung der äußeren Halshaut und keine offen gebliebenen Kiemenspalten. Der Bezug auf die Stammesgeschichte erweist sich als unnötig und kann daher fallengelassen werden.

Abb. 202: Schematische Darstellung eines atavistischen Oberschenkelknochens und eines atavistischen Unterschenkelknochens mit Nerven, Muskeln und Gefäßen beim Pottwal Physeter catodon. ab Abdominalknochen, ar Arterie, e Epidermis, f Femur, m Muskel, n Nerv, s Walfischspeck, t Tibia. Nach Ogawa & Kamiya (1957) A case of the cachalot with protruded rudimentary hind limbs. Sci. Rep. Whales Res. Inst. 12, 197-208.
Eventuell ähnlich zu beurteilen sind atavistische Hinterextremitätenstummel bei Walen (Abb. 202). Sie lassen sich ebenfalls als missgebildete „Kopie“ von Teilen der Vorderextremitäten deuten. Daher ist es nicht zwingend, „eingeschlafene Gene“ zu postulieren, die „versehentlich“ reaktiviert werden und dadurch zum Auftreten von Atavismen führen. Davon abgesehen ist zu erwarten, dass über lange Zeiträume nicht benötigte Gene aufgrund des Wegfalls der Selektion durch Mutationen so starke Defekte erleiden, dass sie nicht mehr reaktivierbar sind. Doch liefert dieses Beispiel ein vergleichsweise gutes Argument für die evolutionstheoretische Deutung, da – im Gegensatz zum Beispiel der vierflügeligen Fruchtfliegen – die atavistische Struktur kein Ersatz für eine andere Struktur ist (bei der Fruchtfliege: Ersatz für die Schwingkölbchen), sondern zusätzlich auftritt. Das in den letzten Jahren gewonnene Verständnis über die Funktionen von Hox-Genen (s. „Homeobox-Gene und Evolution“ (https://genesis-net.de/e/1-3-c/3-5/)) bei der Bildung von Körperachsen und Extremitäten bei Wirbeltieren eröffnet eine Klärung dieses Phänomens (und anderer) als krankhafte homeotische Fehlbildung.
Bei der Interpretation von Missbildungen als Atavismen gilt wie bei Rudimenten: Alle Deutungen sind voreilig, solange die zugrundeliegende genetische und entwicklungsphysiologische Situation und die wachstumsfunktionelle Bedeutung der normalen Bildungen nicht bekannt sind.
1.4 Zusammenfassung
Manche gelegentlich auftretenden Missbildungen können als Atavismen interpretiert werden und gelten daher als Evolutionsbelege. Diese Interpretation ist jedoch nur in Ausnahmefällen anwendbar, und nur dann, wenn ein bestimmter Evolutionsverlauf bereits vorausgesetzt wird. Daher stellen Atavismen keine unabhängigen Belege für Evolution dar. Zudem kann das Auftreten von Atavismen auch verständlich gemacht werden, ohne dass eine vorausgegangene Evolution zur Erklärung benötigt wird.
Literatur
Junker R (2000) Ähnlichkeiten, Rudimente, Atavismen. Holzgerlingen. Reihe Studium Integrale, Kapitel 9.
Autor: Reinhard Junker, 08.04.2005
Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2005, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i41304.php