Ursuppen-Simulationsexperimente
In Simulationsexperimenten wird versucht, Moleküle der Lebewesen aus anorganischen Ausgangsstoffen unter Energieeinwirkung herzustellen. Die dabei entstehenden Gemische werden als „Ursuppen“ bezeichnet. Dabei wird von solchen Ausgangsstoffen ausgegangen, die unter chemischen Gesichtspunkten am ehesten erfolgversprechend sind.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel wird der Versuchsansatz von „Ursuppen“-Simulationsexperimenten vorgestellt und kritisch bewertet.
1.1 Hinführung
Stanley Miller gab 1953 mit seiner Veröffentlichung „A production of amino acids under possible primitive Earth conditions“ („Herstellung von Aminosäuren unter möglichen Bedingungen einer einfachen Erde“) einen entscheidenden Impuls zur experimentellen Prüfung von Modellen zur Lebensentstehung. Entsprechend den von H. Urey publizierten Vermutungen über die Zusammensetzung der Uratmosphäre der Erde (vgl. „Hypothesen zur Uratmosphäre“ (https://genesis-net.de/x/1-5/2-1/)) simulierte er eine hypothetische [= vermutete, angenommene] frühe Erde im Labor. In Abb. 115 ist ein typischer Versuchsaufbau für ein Miller-Simulationsexperiment dargestellt. Nach mehrtägiger Einwirkung von elektrischen Funkenentladungen auf ein entsprechendes Gasgemisch bildet sich ein heterogenes Produktgemisch. Das wässrige, gefärbte Produktgemisch wurde in der Folgezeit vielsagend als „Ursuppe“ bezeichnet. Aus dem Rohprodukt konnte Miller – allerdings erst nach entsprechender Aufarbeitung – einige organische Verbindungen isolieren und nachweisen. Unter den Reaktionsprodukten fanden sich neben vielen anderen Stoffen auch einige Aminosäuren. Darunter wiederum waren auch solche Aminosäuren, die in Lebewesen vorkommen.
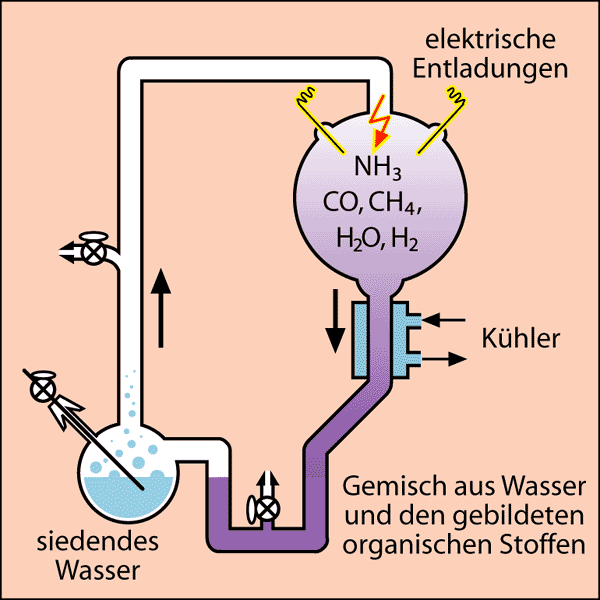
Abb. 115: Versuchsapparatur nach Stanley Miller. Typische Versuchsapparatur (ca. 60 cm hoch), wie sie erstmals von Stanley Miller im Jahre 1953 eingesetzt wurde. Mit ihr konnte die Bildung organischer Verbindungen aus anorganischen Stoffen unter mutmaßlichen „Uratmosphären“-Bedingungen nachgewiesen werden.
Die Erfahrungen bei den bis heute in vielen Varianten durchgeführten Ursuppen-Simulationsexperimenten zeigen: unter Anwendung chemischen Know-hows kann man aus Gasmischungen einige für heute bekannte Lebewesen notwendige Stoffe herstellen. Damit ist eine Entsprechung zu einer hypothetischen frühen Erde, d. h. Abwesenheit spezieller Randbedingungen nicht gegeben, denn das chemische Know-how fehlt dort ja gerade.
1.2 Ansatz vom gewünschten Ergebnis her bestimmt
Weiter ist kritisch zu bewerten: Der experimentelle Ansatz in Millers Simulationsexperiment (Abb. 115) ist ausgehend vom erwarteten bzw. erhofften Resultat (nämlich: biologisch bedeutsame Syntheseprodukte) konzipiert. Dies soll am Beispiel des Kohlenstoffs dargestellt werden: Kohlenstoff (C) wird in reduzierter Form als Methan (CH4) vorgegeben. Würde man den Kohlenstoff dagegen z. B. in Kombination mit Sauerstoff (O) als oxidierte Verbindung in Form von Kohlendioxid (CO2) einsetzen, so stünde der Kohlenstoff nicht für den Aufbau komplexer Moleküle zur Verfügung. Die Ursache dafür ist, dass CO2 eine sehr beständige Verbindung darstellt und erst mit entsprechendem Aufwand reduziert werden müsste.
Es müssten also präbiotische [= vor der Existenz von Leben] Mechanismen postuliert werden, die den oxidierten Kohlenstoff wieder reduzieren. Das ist zwar prinzipiell möglich, macht aber das Modell insgesamt komplizierter. Dies steht der Zielsetzung präbiotischer Modelle zur Lebensentstehung entgegen, nämlich von möglichst unspezifischen („primitiven“) Bedingungen auszugehen.
Bis heute sind Versuche dieser Art unter vielfacher Variation der Gaszusammensetzung und -konzentrationen sowie der Energiequellen wiederholt worden. Im Artikel „Entstehung von Proteinen“ (https://genesis-net.de/x/1-5/3-1/) werden die Resultate solcher Ursuppen-Simulationsexperimente vorgestellt und deren Bedeutung für die Modelle zur Lebensentstehung diskutiert.
Literaturhinweis: R. Junker & S. Scherer: Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen, 2001, Kapitel IV.8
Autor: Harald Binder, 10.04.2004
Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i42042.php