Entstehung von Zellmembranen
Lebewesen benötigen Abgrenzungen gegen die Umwelt in Form von Membranen (Zellhüllen). Mit der Abgrenzung ist zugleich aber auch die Fähigkeit zum Stoffaustausch mit der Umgebung erforderlich. Heutige Zellmembranen zeigen einen entsprechend komplexen Aufbau, der diese unterschiedlichen Anforderungen erfüllen kann. Wie solche Gebilde erstmals zufällig entstanden sein könnten, ist unbekannt.
1.0 Inhalt
In diesem Artikel wird der Aufbau von Membranen skizziert und dargestellt, welche Komponenten und Eigenschaften sie aufweisen müssen, damit sie als Umhüllungen von lebenden Zellen geeignet sind. Ihre Entstehungsweise ist unbekannt.
1.1 Wie entstanden die ersten Membranen?
In irgendeinem Stadium der Lebensentstehung müssen die bis dahin gebildeten Komponenten von ihrer Umgebung getrennt werden. Nur dadurch kann deren Verlust z. B. durch Verdünnung oder unerwünschte Reaktionen verhindert werden. Diese und viele andere Funktionen werden heute von Membranen [= Zellumhüllung] erfüllt. Stadien erster membranumschlossener Systeme sind in jedem Lebensentstehungsmodell ein elementarer Bestandteil. Über den Zeitpunkt, an dem Membranen erstmals auftreten, werden unterschiedliche Vorstellungen diskutiert.
Ein Hauptbestandteil von Biomembranen sind Phospholipide (Abb. 177), bestehend aus Glycerin, Phosphorsäure und langkettigen aliphatischen Verbindungen (welche mit Glyzerin als Ether oder Ester verknüpft sind). Diese Moleküle weisen wie alle grenzflächenaktiven Substanzen (Tenside) einen hydrophoben [= wassermeidenden] und einen hydrophilen [= wasserverträglichen] Bereich auf (vgl. Abb. 178). Moleküle mit diesen Strukturmerkmalen können sich spontan zu Aggregaten (z. B. Doppelschichten, Mizellen, Vesikel) zusammenlagern. Plausible Synthesemöglichkeiten solcher Substanzen unter präbiotischen Bedingungen sind jedoch unbekannt.
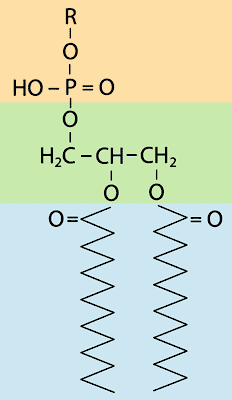
Abb. 177: Aufbau eines Phospholipids
1.2 Wie entstehen Membranen heute?
Biologisch aktive Membranen, wie wir sie von lebenden Zellen kennen, entstehen immer aus bereits existierenden und werden nicht de novo [= von Neuem, von Grund auf neu] synthetisiert. Zu den Aufgaben von Biomembranen gehört nicht nur die Abgrenzung der Zelle gegen die Umgebung. Zellmembranen sind so aufgebaut, dass unterschiedliche Stoffe, wie z. B. Wasser, Mineralien, Nähr- und Abfallstoffe passiv und aktiv durch diese Abgrenzung hindurch transportiert werden können. Der komplexe Aufbau von Biomembranen spiegelt die vielfältigen Aufgaben (wie z. B. Erkennungsmechanismen, Zell-Zell-Kommunikation) von Zellmembranen wieder (vgl. Abb. 179).
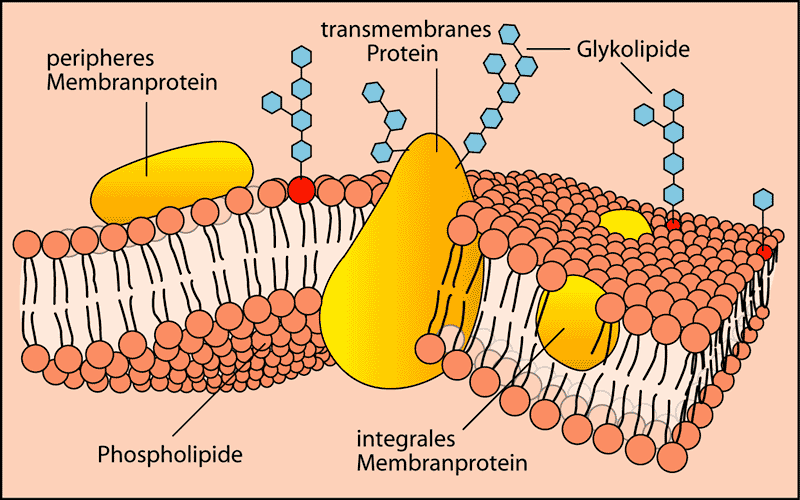
Abb. 179: Aufbau Zellmembran. Zellmembranen bestehen neben einem „Gerüst“ aus einer Lipid-Doppelschicht aus einer großen Anzahl verschiedener Proteine und Kohlenhydrate (Verbindungen mit C6-Ringen, durch Sechsecke dargestellt; diese symbolisieren Hexopyranoseeinheiten). Diese werden für einen geregelten Stoffaustausch mit der Umgebung benötigt. Biologische Membranen sind äußerst komplexe Gebilde, an deren Erforschung intensiv gearbeitet wird.
Wenn replikationsfähige [= vervielfältigbare] Reaktionssysteme durch eine Membran eingehüllt und somit gegen die Umgebung abgegrenzt werden, würde das gleichzeitig ihr Ende bedeuten, wenn nicht von Beginn an differenzierte Transportmechanismen durch die Membran gewährleistet sind. Nach bisherigen Kenntnissen müssten also mit der Bildung von Membranen praktisch gleichzeitig auch erste Transportfunktionen vorhanden sein. Diese komplexen Anforderungen von Beginn an machen eine präbiotische Entstehung schwer vorstellbar.
1.3 Mikrosphären
Fox erhielt bei Verrühren der im Artikel „Entstehung von Proteinen“ (https://genesis-net.de/x/1-5/3-1/) erwähnten Proteinoide in Wasser Gebilde, die er aufgrund ihrer mikroskopischen Erscheinung als Mikrosphären bezeichnete und als Protoorganismen ansah. Solche entfernt an Zellen erinnernde Strukturen lassen sich jedoch auch durch Trocknen verschiedener synthetischer Polymerlösungen erhalten und haben nichts mit biologischen Zellen zu tun. Die von Fox beschriebenen proteinoiden Mikrosphären spielen in der aktuellen Diskussion von Modellen zur Lebensentstehung keine Rolle mehr.
Literatur
R. Junker & S. Scherer (2001) Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen, Kapitel IV.8
Autor: Harald Binder, 21.10.2004
Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i42063.php