Artbegriffe
Der Artbegriff ist grundlegend für die Biologie. Trotz intensiver Bemühungen konnte bislang noch kein für alle Organismen passender und allgemein akzeptierter Artbegriff festgelegt werden.
1.0 Inhalt
Je nach Gewichtung genetischer (kreuzungsbiologischer) oder morphologischer (gestaltlicher) Merkmale ergeben sich oft verschiedene Artgrenzen. Entsprechend werden genetische und morphologische Artbegriffe unterschieden. Darüber hinaus ist die evolutionäre Art in der Phylogenetik (Stammbaumrekonstruktion) von Bedeutung.
1.1 Was ist eine Art?
Grundlegend für die Evolutionsbiologie ist der Artbegriff. Ein allgemein akzeptiertes Artkonzept liegt allerdings nicht vor. Es kursieren unterschiedliche Artbegriffe, die in verschiedenen Zusammenhängen zweckmäßig sind:
Biologische Art, Biospezies: Gruppe von Individuen oder Populationen, die miteinander unter natürlichen Bedingungen fruchtbare Nachkommen hervorbringen können
Morphospezies: Gruppe von Individuen oder Populationen, die in den wesentlichen gestaltlichen, physiologischen und biochemischen Merkmalen übereinstimmen.
Grundtyp: Alle Individuen, die direkt oder indirekt durch Kreuzungen verbunden sind, unabhängig von der Fruchtbarkeit der Nachkommen.
Evolutionäre Art: Gruppe von Individuen oder Populationen, die von der Aufspaltung einer Art bis zur nächsten Trennung in Folgearten verläuft.
Bei vielen Fragestellungen, die mit dem Artbegriff zu tun haben, muss geklärt sein, welcher Artbegriff zugrunde liegt. Wenn beispielsweise behauptet wird, es sei noch nicht gelungen, eine Art in eine andere zu transformieren, so fällt die Antwort unterschiedlich aus, je nachdem, was mit „Art“ gemeint ist.
1.2 Genetische Artbegriffe
Genetische Artbegriffe beruhen auf der Kreuzbarkeit von Tieren oder Pflanzen: es muss festgestellt werden, ob Nachkommen erzeugt werden können. Als entscheidend werden also bestimmte Gemeinsamkeiten des Erbguts (Genom) angesehen, die mit der Fortpflanzung zu tun haben.
Als gebräuchlichster Artbegriff gilt die Biospezies („biologische Art“):
Zu ein und derselben Biospezies gehören alle Individuen, die unter natürlichen Bedingungen fruchtbare Nachkommen hervorbringen können.
Hier sind die Kriterien für die Zugehörigkeit zur selben Art recht eng gefasst:
1. Wie bei allen genetischen Artbegriffen wird die Fähigkeit, Nachkommen zu erzeugen, gefordert.
2. Die Nachkommen müssen „unter natürlichen Bedingungen“, d. h. in den natürlichen Lebensräumen, erzeugt werden. Kreuzungen, die unter Zuchtbedingungen auftreten, werden nicht berücksichtigt.
3. Die Nachkommen müssen fruchtbar sein, also selber wieder Nachkommen erzeugen können.
Beispielsweise gehören Pferde, Esel und Zebras verschiedenen Biospezies an. Sie können zwar miteinander gekreuzt werden (vgl. Abb. 27), doch die Mischlinge sind nicht fruchtbar (die dritte Bedingung ist nicht erfüllt).
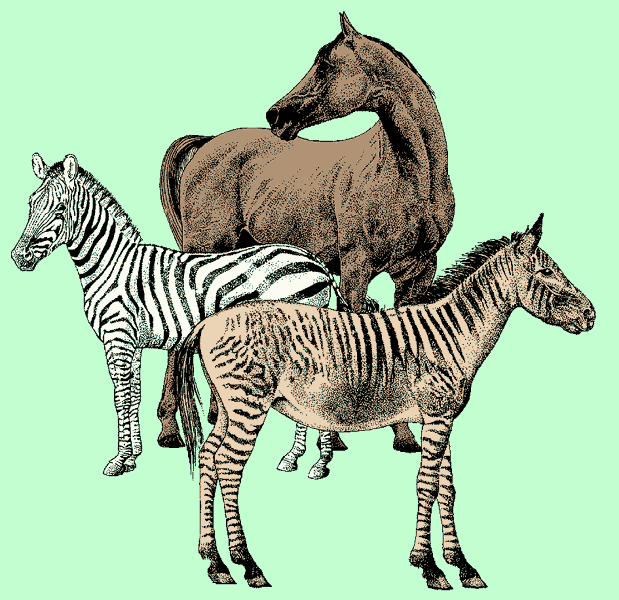
Abb. 27: Pferde und Zebras können sich in der Regel nicht fruchtbar kreuzen und gehören daher verschiedenen Biospezies an. Die Mischlinge (Zebroide, unten) sind unfruchtbar.
Weiter gefasste genetische Artbegriffe verzichten auf die Forderung der Nachkommenproduktion unter natürlichen Bedingungen und / oder auf die Forderung der Fruchtbarkeit der Mischlinge. Dies gilt insbesondere für den Grundtypbegriff.
Alle Individuen, die direkt oder indirekt durch Kreuzungen verbunden sind, werden zu einem Grundtyp gerechnet.
Von den für Biospezies geforderten Bedingungen muss nur die erste erfüllt sein. „Kreuzbarkeit“ heißt dabei genauer:
• Es kommt zu einer echten Befruchtung.
• Die Embryonalentwicklung beginnt.
• Das Erbgut beider Elternarten wird ausgeprägt.
Nicht gefordert wird, dass der Mischling erwachsen wird, auch nicht die Fruchtbarkeit der Mischlinge und das Auftreten von Mischlingen in freier Wildbahn.
Als bekanntes Beispiel für einen Grundtyp seien die Pferdeartigen – Pferde, Esel und Zebras – genannt. Sie gehören verschiedenen Biospezies an, denn ihre Mischlinge sind unfruchtbar (s. o.); jedoch sind sie Mitglieder desselben Grundtyps, da Mischlinge erzeugt werden können und Merkmale beider Elternarten aufweisen. Abb. 28 zeigt als weiteres Beispiel die Entenartigen. Der Grundtypbegriff spielt im Rahmen der Schöpfungslehre („Grundtypenbiologie“ (https://genesis-net.de/s/0-3/)) eine besondere Rolle.

Abb. 28: Einige Arten des Grundtyps der Entenartigen. Obere Reihe: Kanadagans, Rothalsgans, Trompeterschwan, Schwarzhalsschwan, untere Reihe: Mittelsäger, Stockente, Mandarinente, Laysan-Stockente, Afrikanische Zwergglanzente.
1.3 Morphologische Artbegriffe
Morphologischen Artbegriffen liegen Merkmale des Baus und der Gestalt der Organismen zugrunde. Grundlagen sind also die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Merkmalsausprägung. Auch physiologische und molekularbio-
logische Merkmale können dabei Berücksichtigung finden. Beispielsweise wird die Morphospezies wie folgt definiert:
Alle Individuen, die in den wesentlichen gestaltlichen, physiologischen und bio-
chemischen Merkmalen übereinstimmen, gehören zu einer Morphospezies.
1.4 Evolutionäre Art
Evolutionäre Arten werden anhand rekonstruierter Stammbäume ermittelt und repräsentieren eine Abstammungslinie zwischen zwei evolutionären Aufspaltungen (Abb. 29).
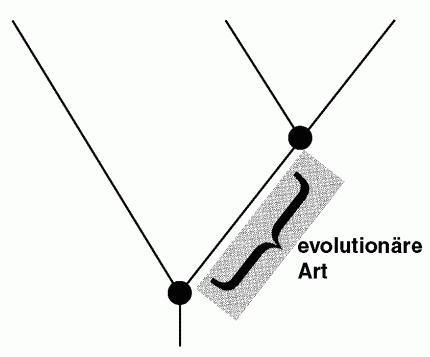
Abb. 29: Eine evolutionäre Art verläuft von der Aufspaltung einer Art bis zur nächsten Trennung.
Alle Individuen oder Populationen, die von der Aufspaltung einer Art bis zur nächsten Trennung in Folgearten verlaufen, gehören zu einer evolutionären Art.
1.5 Verschiedene Abgrenzungen je nach Artbegriff
Bei Anwendung der verschiedenen Artbegriffe resultieren oft unterschiedliche Ergebnisse. So können beispielsweise Angehörige derselben morphologischen Art zu verschiedenen genetischen Arten gehören. Beispielsweise sind Grünspecht und Grauspecht in ihrer Gestalt und Befiederung kaum verschieden. (Abb. 30). Sie kreuzen sich jedoch kaum, obwohl ihre Verbreitungsgebiete teilweise überlappen. Daher werden sie als zwei verschiedene Biospezies auseinandergehalten („eine Morphospezies = zwei Biospezies“).

Abb. 30: Grünspecht und Grauspecht könnten als eine einzige morphologische Art aufgefasst werden. Da sie sich im Freiland kaum kreuzen, werden sie zu verschiedenen Biospezies gestellt.
Umgekehrt gibt es viele Fälle, in denen morphologisch klar unterscheidbare Arten leicht kreuzbar sind und auch in freier Wildbahn fruchtbare Mischlinge produzieren: „Eine Biospezies = zwei Morphospezies“.
1.6 Sind Artbegriffe objektiv?
Offenkundig unterliegt der Morphospezies-Begriff subjektiven Wertungen. Denn darüber, ob bestimmte Merkmale wesentlich oder unwesentlich sind, können die Meinungen auseinandergehen; eine objektive Messung ist kaum möglich. Genauso wenig kann objektiv angegeben werden, wie viele Unterschiede und welche „Qualität“ von Unterschieden nötig sind, um Arten zu trennen. Dennoch finden morphologische Artbegriffe in der Biologie nach wie vor eine überraschend häufige Anwendung.
Auf den ersten Blick erscheint das Biospezies-Kriterium weniger subjektiv als morphologisch begründete Artbegriffe. Doch erlaubt auch die Biospezies-Definition in vielen Fällen keine scharfe Abgrenzung. Denn wo liegt die Grenze zwischen natürlichen und unnatürlichen Bedingungen? Ist ein Wildreservat oder ein Wildpark noch natürlich? Auch das Kriterium der fruchtbaren Kreuzbarkeit ist unscharf. Es sind nämlich in verschiedenen Fällen alle Übergänge von vollständiger Fruchtbarkeit von Mischlingen bis vollständiger Sterilität bekannt. Ab welchem zahlenmäßigen Anteil fruchtbarer Mischlinge bei einem Kreuzungspaar soll nun das Biospezies-Kriterium erfüllt sein? Die Grenzen zwischen „fruchtbar“ und „unfruchtbar“ sind offenbar auch fließend.
Der wesentlich weiter gefasste Grundtypbegriff vermeidet diese Unschärfen und kann daher als relativ objektiv gelten. Allerdings gibt es auch hier Unschärfen, wenn es darum geht, genau zu fassen, was die in der Definition geforderte „Ausprägung des Erbguts beider Elternarten“ genau bedeutet.
Autor: Reinhard Junker, 01.01.2004
Aktualisiert am 07.01.2024 (B. Scholl); © beim Autor; alter Link: 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i41224.php